Tipp: In Deutschland sind elektronische Signaturen längst rechtlich anerkannt. Digitale Lösungen wie Skribble bieten eine rechtssichere und effiziente Vertragsunterzeichnung – lokal verankert und EU-weit gültig.
B2B-Verträge in Deutschland: Rechtssicherheit, Effizienz & digitale Signatur

Einführung in B2B-Verträge
Warum sind B2B-Verträge für deutsche Unternehmen entscheidend?
B2B-Verträge bilden das Fundament für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen – und gerade im deutschen Kontext sind eindeutige, verlässliche Regeln im Vertragswesen besonders gefragt. Durch klar formulierte Verträge werden Warenlieferungen, Dienstleistungen und Kooperationen nicht nur rechtsverbindlich geregelt, sondern auch das wirtschaftliche Fundament der Geschäftspartner gestärkt. Fehlende oder unpräzise Verträge führen schnell zu Unsicherheiten, unklaren Zuständigkeiten oder rechtlichen Konflikten. Studien zeigen, dass Unternehmen mit sorgfältig ausgearbeiteten B2B-Verträgen Risiken deutlich reduzieren, nachhaltige Partnerschaften aufbauen und ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern[1] (Deloitte: Vertragsmanagement).
Herausforderungen bei der Erstellung von B2B-Verträgen in Deutschland
Die Erstellung von B2B-Verträgen erfordert in Deutschland nicht nur tiefgehende juristische Erfahrung, sondern auch den souveränen Umgang mit nationalen und internationalen Rechtsvorschriften. Typische Herausforderungen sind:
- Präzise Leistungsbeschreibungen: Exaktheit ist für Steuerung und Kontrolle unumgänglich, damit beide Seiten genau wissen, was geliefert oder geleistet wird.
- Haftungs- und Gewährleistungsfragen: Unterschiedliche Interpretationen und rechtliche Regelungen können zu Streitpunkten werden – etwa bei Mängelhaftung oder Schadenersatz.
- Branchen- und länderspezifische Vorgaben: Unternehmen, die international agieren, müssen deutsche und EU-Anforderungen integrieren (z. B. Datenschutz, Exportbestimmungen).
- Integration digitaler Tools: Moderne Vertragsverwaltung mit eSigning, etwa mit Skribble, steigert Sicherheit und Effizienz durch automatische Nachverfolgung und digitale Archivierung.
Ein häufiges Praxisproblem: Unklare Zuständigkeiten und lückenhafte Dokumentation erschweren das Vertragsmanagement erheblich. Unternehmen sollten daher frühzeitig klare Prozesse und Verantwortlichkeiten definieren.
Definition: Was ist ein B2B-Vertrag?
Merkmale eines B2B-Vertrags – deutscher Fokus
Ein B2B-Vertrag – oft auch Zusammenarbeitsvertrag zwischen Unternehmen genannt – ist eine rechtlich bindende Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Unternehmen. Die Zusammenarbeitsvertrag Definition in Deutschland umfasst dabei spezifische Merkmale:
- Vertragspartner: Es agieren ausschließlich Unternehmen oder andere juristische Personen als Parteien.
- Inhaltliche Flexibilität: Rechte und Pflichten werden individuell festgelegt – hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind möglich, da kaum zwingende Verbraucherschutznormen greifen.
- Vertragstypen: Diese variieren je nach Branche (Liefervertrag, Dienstleistungsvertrag, Partnerschaftsvertrag, Lizenzvertrag etc.), was spezialisierte Regelungen erfordert.
- Vertragspraxis: Die deutsche Vertragskultur legt großen Wert auf Transparenz, Klarheit und Nachvollziehbarkeit. Verständliche und umfassende Klauseln sind essenziell, um Missverständnisse zu vermeiden.
Hinweis: Besonders wichtig ist die eindeutige schriftliche Dokumentation – idealerweise digital signiert mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES), wie sie Anbieter Skribble bereitstellen. Eine QES ist in Deutschland und der EU der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt und sorgt für maximale Beweiskraft.
Typische Inhalte: Was sollte ein deutscher B2B-Vertrag enthalten?
Ein effektiver B2B-Vertrag für deutsche Unternehmen beinhaltet im Allgemeinen folgende Punkte:
- Leistungen & Pflichten: Was wird konkret geliefert oder geleistet und nach welchen Qualitätskriterien? (Klare Spezifikation der Produkte/Dienstleistungen)
- Vertragsdauer & Kündigung: Vereinbarte Laufzeiten, Kündigungsfristen und Verlängerungsklauseln.
- Zahlung & Preisgestaltung: Zahlungsziele, Währung (bei internationalem Geschäft), vereinbarte Preise, Rabatte oder Skonto und Konsequenzen bei Zahlungsverzug.
- Haftung & Gewährleistung: Verteilung von Risiken, Haftungsbeschränkungen, Gewährleistungsrechte und Garantien. (Wer haftet wofür und in welcher Höhe?)
- Vertraulichkeit: Der Umgang mit geschützten Informationen und Betriebsgeheimnissen, geregelt durch Geheimhaltungs- oder NDA-Klauseln, unter Beachtung der Datenschutzvorgaben (z. B. DSGVO).
- Konfliktlösung: Mechanismen zur Streitbeilegung wie Schiedsgerichtsklauseln, Gerichtsstandvereinbarungen oder Mediation, um im Konfliktfall Klarheit zu haben.
- Besondere Klauseln: Einbindung elektronischer Signaturen und Einhaltung relevanter nationaler sowie EU-Vorschriften. Je nach Branche können auch branchenspezifische Regelungen oder regionale Besonderheiten eine Rolle spielen (z. B. lokale Sicherheitsstandards, Normen).
Empfohlene Vorgehensweise: Halten Sie B2B-Verträge immer schriftlich und so detailliert wie nötig. Nutzen Sie dabei moderne digitale Vertragsmanagement-Lösungen für maximale Sicherheit und Nachverfolgbarkeit. Ein gut dokumentierter Vertrag – idealerweise digital erstellt und unterschrieben – erleichtert die Zusammenarbeit und minimiert spätere Streitigkeiten.
Rechtlicher Rahmen für B2B-Geschäfte in Deutschland
Gesetzliche Anforderungen: Das gilt beim Vertrag zwischen Firmen
In Deutschland unterliegen B2B-Verträge hauptsächlich dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und – bei Geschäften zwischen Kaufleuten – ergänzend dem Handelsgesetzbuch (HGB). Bei internationalen Sachverhalten legt das Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB) – als Umsetzung der Rom-I-Verordnung – das anwendbare Recht für den Vertrag fest. Zentrale Aspekte für jeden Vertrag zwischen Firmen sind:
- Vertragsfreiheit: Unternehmen können ihre Vereinbarungen weitgehend frei gestalten. Inhalt und Form des Vertrags sind grundsätzlich frei wählbar, solange keine Gesetze verletzt werden.
- Geschäftsfähigkeit der Partner: Verträge sind nur gültig zwischen geschäftsfähigen Parteien. Beide Unternehmen müssen rechtlich existieren und durch vertretungsberechtigte Personen handeln.
- Formfreiheit: Für B2B-Verträge gilt im Regelfall Formfreiheit. Eine bestimmte Form (schriftlich oder notariell) ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird aber bei größeren Investitionen oder internationalen Geschäften dringend empfohlen – heutzutage auch elektronisch (z. B. via QES) umsetzbar.
- AGB und kaufmännisches Bestätigungsschreiben: Allgemeine Geschäftsbedingungen können in B2B-Verträgen frei vereinbart werden, unterliegen aber den §§ 305–310 BGB. Insbesondere grob benachteiligende oder überraschende Klauseln sind unwirksam, auch im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmern. Das kaufmännische Bestätigungsschreiben als Institut des Handelsrechts erlaubt es, mündliche Absprachen im Nachgang per Schriftstück zu bestätigen – schweigt der Empfänger (wenn beide Seiten Kaufleute sind), gilt der Inhalt als anerkannt. Diese praxisgeprägte Regel erleichtert Vertragsabschlüsse im Geschäftsleben erheblich.
Tipp: Für rechtssichere Unterschriftsprozesse empfiehlt sich der Einsatz von qualifizierten elektronischen Signaturen – sie erfüllen die strengen deutschen und EU-Vorgaben (eIDAS-Verordnung) und bieten volle Nachvollziehbarkeit. So wird die digitale Unterschrift zum vollwertigen Ersatz der handschriftlichen.
Berücksichtigung von EU-Vorschriften & internationalen Aspekten
Deutsche Unternehmen müssen neben nationalen Gesetzen auch einschlägige EU-Vorschriften beachten, insbesondere bei grenzüberschreitenden Verträgen innerhalb Europas:
- EU-Richtlinien und -Verordnungen: Etwa die Verbraucherschutzrichtlinien oder die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben Auswirkungen auf Vertragsinhalte, z. B. Informationspflichten oder Datenschutzklauseln. Die EU-Verordnung Nr. 1215/2012 regelt beispielsweise die internationale Zuständigkeit von Gerichten innerhalb der EU, und die Rom-I-Verordnung (EG Nr. 593/2008) legt fest, welches Recht auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwenden ist.
- UN-Kaufrecht (CISG): Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf kann auf B2B-Kaufverträge Anwendung finden, wenn es nicht vertraglich ausgeschlossen wird. Bei internationalen Warenlieferungen zwischen Unternehmen tritt das CISG automatisch in Kraft, sofern beide Länder Vertragsstaaten sind.
- Gerichtsstand und anwendbares Recht: Bei Vertragspartnern im Ausland sind der Sitz der Parteien, der Gerichtsstand und das anzuwendende Recht besonders relevant. Diese sollten vertraglich geregelt werden, um im Streitfall Klarheit zu haben (z. B. Gerichtsstand Deutschland und Rechtswahl deutsches Recht oder eine Schiedsgerichtsklausel).
Praxis-Tipp: Deutsche Unternehmen profitieren von Vertragsvorlagen, die sowohl EU-Vorgaben als auch nationale Besonderheiten berücksichtigen – und vom Einsatz etablierter elektronischer Signaturdienste wie Skribble, die EU-weit anerkannt sind. So stellen Sie sicher, dass Verträge im In- und Ausland rechtskonform und effizient abgeschlossen werden können.
Rechtliche Unterschiede: Schutz & Flexibilität
Im B2B-Bereich gilt: Man geht davon aus, dass beide Vertragsparteien geschäftserfahren und risikobewusst sind – dadurch unterliegen sie weniger Schutzbestimmungen als Verbraucher. Konkret können in einem Vertrag zwischen zwei Unternehmen viele Rechte und Pflichten frei vereinbart oder sogar vertraglich ausgeschlossen werden:
- Widerrufsrecht: Ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht im B2B nicht. Unternehmer haben kein automatisches Rücktrittsrecht nach Vertragsschluss, es sei denn, es wird ihnen vertraglich eingeräumt.
- Informationspflichten: Diese sind weniger umfangreich ausgeprägt. Anders als im Verbrauchergeschäft müssen Unternehmen einander nicht über ein gesetzliches Muster-Widerrufsformular oder ähnliche Verbraucherinformationen belehren.
- Gewährleistungsfristen: Können im B2B-Vertrag verkürzt oder spezifisch angepasst werden. Beispielsweise ist es üblich, die Verjährungsfrist für Mängelansprüche auf 12 Monate zu begrenzen – was im B2C für neue Waren nicht unter 2 Jahre möglich wäre.
- Kollaborative Klauseln: Spezielle Vereinbarungen wie Back-to-Back-Klauseln, die Pflichten entlang der gesamten Lieferkette abstimmen und so verhindern, dass Lücken oder Haftungsfallen entstehen (dazu unten mehr). Solche Klauseln können im B2B frei gestaltet werden, da keine Verbraucherschutzvorgaben dem entgegenstehen.
Im Endkundengeschäft (B2C) hingegen sieht das deutsche Recht einen deutlich verstärkten Schutz des Verbrauchers vor. Beispielsweise bestehen hier gesetzlich garantierte Rücktritts- bzw. Widerrufsrechte, umfangreiche Informationspflichten und Mindestgewährleistungsfristen zum Schutz der Verbraucher. Viele dieser Schutzvorschriften sind zwingend und können nicht zu Ungunsten des Verbrauchers vertraglich abgeändert werden.
Studien belegen, dass Unternehmen in Deutschland die größere Flexibilität bei B2B-Verträgen gezielt nutzen, um marktspezifische Lösungen zu schaffen[7] (BMJ: Verbraucherrecht FAQ). Das bedeutet, Vertragsklauseln werden im B2B-Bereich oft kreativ und passgenau eingesetzt, um die Geschäftsbeziehung optimal zu gestalten – während im B2C-Bereich der Spielraum durch Verbraucherschutz eingeschränkt ist.
Sie möchten das Signieren mit der E-Signatur gleich ausprobieren?
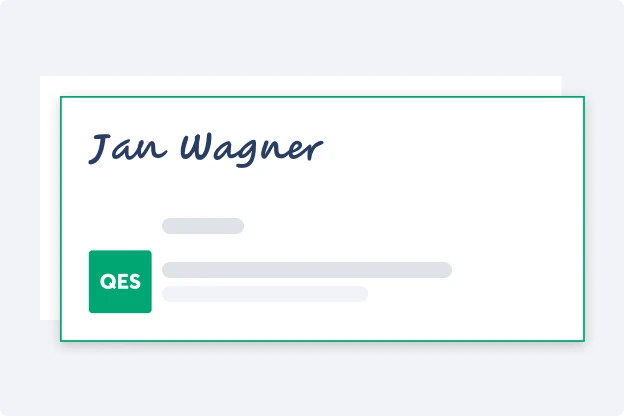
Wichtige Elemente von B2B-Verträgen
Vertragsklauseln und „Back-to-Back Vereinbarung“
Das Herzstück eines erfolgreichen B2B-Vertrags sind individuell ausgehandelte Vertragsklauseln, die alle geschäftskritischen Aspekte abdecken. Wichtige Klausel-Themen sind unter anderem:
- Leistung & Preis: Exakte Definition der zu erbringenden Leistungen bzw. zu liefernden Waren sowie der Zahlungsbedingungen (Preise, Zahlungszeitpunkt, Währung).
- Liefer- & Zahlungsfristen: Verbindliche Termine und Fristen, ggf. mit Vertragsstrafen oder Bonus/Malus-Regelungen bei Verzögerungen.
- Mängelansprüche & Gewährleistung: Was passiert, wenn die Ware oder Leistung mangelhaft ist? Hier wird geregelt, wer in welchem Umfang haftet, Nachbesserung leistet oder Ersatz liefert.
- Vertraulichkeit: Umgang mit sensiblen Daten und Betriebsgeheimnissen. In B2B-Verträgen sind Vertraulichkeitsklauseln üblich, um z. B. technische Spezifikationen oder Kundendaten zu schützen (Stichwort: Geheimhaltungsvereinbarung), unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen (DSGVO/BDSG).
- Back-to-Back Vereinbarung: Damit ist ein zentrales Instrument vor allem bei komplexen Lieferketten gemeint. Dabei werden die Verpflichtungen aus dem Hauptvertrag nahtlos in entsprechende Unterverträge übernommen. So entstehen keine Lücken oder widersprüchlichen Regelungen zwischen Hauptauftragnehmer und Zulieferern. Diese Vereinbarungen schützen Unternehmen vor ungewollten Risiken und schaffen Planungssicherheit entlang der gesamten Lieferkette.
Klar und umfassend formulierte Klauseln verhindern Missverständnisse – besonders, wenn Unternehmen digitale Vertragslösungen einsetzen und über Standorte hinweg zusammenarbeiten. Je detaillierter die Vereinbarungen, desto einfacher lassen sie sich später auch digital auswerten und nachverfolgen.
Risikomanagement in deutschen B2B-Verträgen
Durchdachtes Risikomanagement ist eine Grundvoraussetzung für nachhaltige Geschäftsbeziehungen. Typische Instrumente zur Risikoabsicherung in B2B-Verträgen sind:
- Haftungsbeschränkungen: Vertragliche Begrenzung der Haftung auf bestimmte Höchstbeträge oder auf bestimmte Schadenarten (z. B. Ausschluss von Folgeschäden), um finanzielle Risiken gezielt einzudämmen.
- Versicherungspflicht: In manchen Branchen oder Verträgen wird vereinbart, dass eine Partei eine Versicherung abschließt (etwa eine Berufshaftpflicht oder Produkthaftpflichtversicherung). Für bestimmte Berufsgruppen ist eine Versicherung sogar gesetzlich zwingend vorgeschrieben (z. B. Architekten, Rechtsberater).
- Exit-Klauseln: Regelungen für den geordneten Ausstieg aus dem Vertrag bei gravierenden Änderungen oder Vertragsstörungen. Dazu zählen Kündigungsklauseln aus wichtigem Grund, Change-of-Control-Klauseln oder Force-Majeure-Klauseln (höhere Gewalt).
- Eskalationsmechanismen: Stufenweises Vorgehen bei Konflikten, bevor der Rechtsweg beschritten wird. Beispielsweise erst Verhandlung auf Fachebene, dann Management-Ebene, dann Mediation und erst zuletzt Gericht. So werden Streitigkeiten möglichst früh entschärft.
- Integration digitaler Kontroll- und Nachverfolgungssysteme: Der Einsatz von digitalen Tools (z. B. Vertragsmanagement-Software mit Fristen-Tracking, Audit-Trails und Reporting) erhöht die Nachvollziehbarkeit aller Vertragspflichten und minimiert Haftungsrisiken nachhaltig.
Die Abstimmung von Pflichten durch eine Back-to-Back Vereinbarung ist für Unternehmen, die als Generalunternehmer auftreten oder internationale Subdienstleister einbinden, besonders relevant. Indem Haupt- und Unterverträge spiegelbildlich gestaltet sind, werden Haftungsfragen und Leistungsumfang über alle Ebenen hinweg konsistent geregelt. So lassen sich Risiken effektiv durchreichen und es entsteht kein „schwarzes Loch“ in der Verantwortlichkeit.
Vorteile digitaler Vertragsmanagement-Tools für deutsche Unternehmen
Effizienzsteigerung durch Digitalisierung & E-Signatur
Digitale Vertragsmanagement-Lösungen bieten signifikante Vorteile für Unternehmen in Deutschland:
- Zentrale, revisionssichere Ablage: Alle Verträge werden digital an einem Ort gespeichert – jederzeit ortsunabhängig abrufbar und gegen Verlust gesichert.
- Automatisierte Fristenüberwachung: Wichtige Termine (Kündigungsfristen, Verlängerungen, Lieferdaten) werden automatisch überwacht. Erinnerungssysteme verhindern, dass Deadlines unbemerkt verstreichen.
- Elektronische Unterschrift: Mit Skribble oder vergleichbaren Anbietern können Verträge rechtsgültig, schnell und sicher digital signiert werden. Medienbrüche entfallen, und der Unterzeichnungsprozess wird erheblich beschleunigt.
- Beschleunigte Zusammenarbeit: Mehrere Parteien können parallel an Vertragsentwürfen arbeiten, Änderungen nachverfolgen und über digitale Plattformen verhandeln. Das verkürzt die Durchlaufzeit erheblich.
- Volle Nachvollziehbarkeit: Alle Änderungen und Versionen werden automatisch protokolliert. Audit-Trails zeigen genau, wer wann welche Änderung vorgenommen hat oder welchen Schritt freigegeben hat.
Studien belegen, dass der Einsatz digitaler Vertragsmanagementsysteme die Durchlaufzeiten von Verträgen um bis zu 50% verkürzt
Kostenersparnis: Digitale Vertragsverwaltung in Deutschland
Durch digitales Vertragsmanagement lassen sich auch beträchtliche Kostenvorteile erzielen:
- Wegfall von Papier, Porto und physischen Archivierungskosten – Verträge müssen nicht mehr ausgedruckt und per Post versendet oder in Aktenschränken gelagert werden.
- Reduktion von Fehlerquellen dank automatisierter Workflows (z. B. automatische Übernahme von Stammdaten, Vorlagen-Prüfung). Weniger Fehler bedeuten weniger kostenintensive Nacharbeiten.
- Optimierter Ressourceneinsatz: Weniger Zeitaufwand für Vertragserstellung, Verwaltung und Kontrolle. Mitarbeiter können sich auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren, anstatt Dokumente manuell zu pflegen.
- Echtzeit-Übersichten: Verantwortliche erhalten Dashboard-Übersichten zum Status aller Verträge. Das spart Personalressourcen im Controlling und verhindert teure Fristversäumnisse (z. B. automatische Verlängerung unerwünschter Verträge).
- Je nach Unternehmensgröße sind bis zu 20 % Einsparungen bei den Verwaltungskosten möglich, wie Branchenstudien zeigen.
Unser Tipp: Die Integration von etablierten E-Signatur-Lösungen wie Skribble sorgt dabei für maximale Rechtssicherheit nach EU-Standards und nationalen Vorgaben. Durch die digitale Signatur und Verwaltung können Verträge schneller, günstiger und sicherer abgeschlossen werden – ein entscheidender Vorteil im B2B-Geschäft.
Schlussfolgerung und Handlungsempfehlung
Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick:
- Digitale, rechtskonforme Vertragserstellung und -unterzeichnung mittels qualifizierter elektronischer Signatur – um Geschwindigkeit mit Rechtssicherheit zu vereinen.
- Klar strukturierte Vertragsklauseln, um Risiken zu minimieren und Verpflichtungen eindeutig festzulegen.
- Flexibilität durch individuell anpassbare Vertragsmodelle (inkl. Back-to-Back Vereinbarungen), die exakt auf die Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind.
- Sicherheit und Transparenz im gesamten Vertragsverlauf durch digitale Vertragsmanagement-Lösungen wie Skribble – von der Erstellung bis zur Archivierung.
Fazit: Investieren Sie in ein durchdachtes Vertragsmanagement, digitale Prozesse und bewährte E-Signatur-Dienste, um Ihre Geschäftsprozesse zukunftssicher zu machen. Moderne B2B-Verträge sind der Schlüssel zu stabilen, rechtskonformen und effizienten Geschäftsbeziehungen – besonders im deutschen Markt. Wer frühzeitig auf digitale Lösungen und klare Verträge setzt, verschafft sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.
Sie möchten das Signieren mit der E-Signatur gleich ausprobieren?
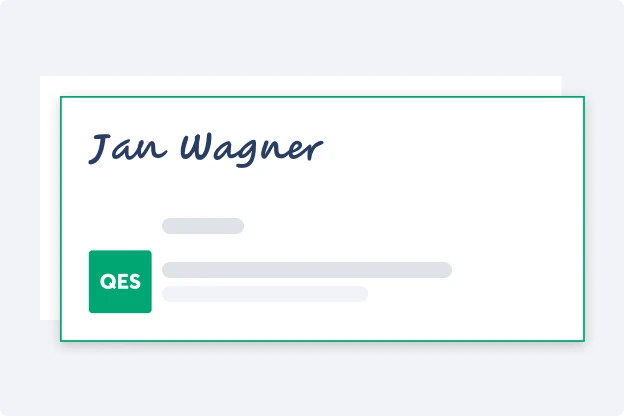
Praktische Tipps zur Implementierung: So gelingt das Vertragsmanagement in Deutschland
Für ein effizientes und rechtssicheres B2B-Vertragsmanagement sollten Sie folgende Praxis-Erfolgsfaktoren beachten:
- Alle relevanten Bereiche frühzeitig einbinden: Bringen Sie Einkauf, Recht, Vertrieb, IT und Fachabteilungen an einen Tisch, bevor Verträge abgeschlossen werden. So stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen und Risiken berücksichtigt sind.
- Transparente Prozesslandkarte erstellen: Definieren Sie klar, wer wann wie für welchen Vertragsabschnitt zuständig ist. Ein visualisierter Workflow vom Vertragsentwurf bis zur Archivierung hilft allen Beteiligten, den Überblick zu behalten.
- Digitale Vertragsverwaltung nutzen: Mit einem spezialisierten Anbieter wie Skribble steigern Sie Transparenz und minimieren Fehler. Verträge können digital erstellt, kollaborativ bearbeitet und elektronisch unterschrieben werden – alles auf einer Plattform.
- Mitarbeiter schulen: Halten Sie Ihr Team in Rechtsfragen und Best Practices auf dem Laufenden. Regelmäßige Schulungen im Vertragsrecht (insbesondere zu neuen Gesetzen oder Urteilen) und im Umgang mit digitalen Tools erhöhen die Vertragsqualität.
Vertragsmodelle kontinuierlich prüfen und optimieren: Überarbeiten Sie bestehende Vertragsvorlagen regelmäßig und passen Sie sie veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen oder Geschäftsanforderungen an. Wo möglich, automatisieren Sie wiederkehrende Vertragsprozesse, um Effizienz und Compliance zu steigern.
Häufige Fragen zu B2B-Verträgen in Deutschland
Grundsätzlich gilt im deutschen B2B-Geschäft die Formfreiheit. Das heißt, Verträge zwischen Unternehmen können mündlich, schriftlich oder elektronisch geschlossen werden; es ist keine notarielle Beurkundung oder ähnliches erforderlich (außer in Sonderfällen, etwa beim Kauf von Grundstücken oder bei bestimmten Gesellschaftsverträgen). Aus Gründen der Beweisbarkeit und Effizienz wird jedoch meist die Schriftform – idealerweise in digitaler Form mit elektronischer Signatur – gewählt. Ein schriftlicher Vertrag (ob auf Papier oder als PDF mit digitaler Signatur) bietet im Streitfall klare Nachweise über den vereinbarten Inhalt und wird daher von den meisten Unternehmen bevorzugt.




